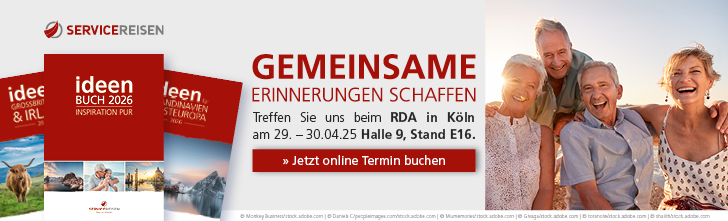In Rheinland-Pfalz haben die kommunalen Spitzenverbände bereits ganz offen mehr finanzielle Unterstützung des Landes für den ÖPNV gefordert. Die Städte und Kreise müssten die massiv steigenden Kosten für den Nahverkehr nahezu allein schultern, so die geschäftsführenden Direktoren des Städtetages und des Landkreistages Lisa Diener und Andreas Göbel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine nachhaltige finanzielle Unterstützung sei nicht in Sicht, im Gegenteil sinke sogar die finanzielle Beteiligung des Landes speziell an der Schülerbeförderung.
Von dem neuen Landesnahverkehrsplan versprechen sich die Verantwortlichen keine positiven Änderungen, denn nur die bestehenden überregionalen Buslinien im Land würden darin als „Pflichtaufgabe“ der Kommunen definiert. In den Städten decke dies jedoch nur rund zehn Prozent des gesamten ÖPNV-Angebots ab, in den Landkreisen gerade mal ein Viertel. „Der Großteil des Bus- und Straßenbahnverkehrs wird somit weiterhin nicht als Pflichtaufgabe definiert und bleibt in der alleinigen Finanzierungsverantwortung der Städte und Kreise“, kritisieren Diener und Göbel. Das Land vermeide damit trotz einer Aufstufung des ÖPNV in eine Pflichtaufgabe einen Mehrbelastungsausgleich nach dem Konnexitätsprinzip. Im Ergebnis erfülle der Landesnahverkehrsplan somit nicht die Erwartungen, die die Kommunen an ihn gestellt hätten.
Kostentreiber ist der Umbau für alternative Antriebe
Der Landesnahverkehrsplan soll die grundlegenden Standards für den ÖPNV in Rheinland-Pfalz festlegen, wobei es u.a. um bessere Kundeninformation, die Wiedererkennbarkeit im Design und mehr Barrierefreiheit sowie Themen wie Sicherheit und Sozialstandards für die Arbeitnehmer gehe. Dadurch, dass das Nahverkehrsgesetz des Landes den ÖPNV zu einer kommunalen Pflichtaufgabe gemacht habe, sei dieser keine freiwillige Aufgabe mehr, die bei knappen Kassen unter den Tisch fallen kann. Die Lage der Kommunen gestalte sich durch die massiven Kostensteigerungen im ÖPNV umso schwieriger. Lohnsteigerungen, Inflation und steigende Energiekosten, Einnahmeverluste durch das Deutschlandticket und gesetzliche Verpflichtungen zur Umstellung auf alternative Antriebe forderten bereits ihren Tribut.
Besonders harsch schlage der Um- und Neubau von Betriebshöfen zu Buche, um die Infrastruktur für alternative Antriebe zu schaffen. In Oberzentren beliefen sich die Investitionen auf mittlere zweistellige Millionenbeträge, ohne dass darin schon die Kosten für den Kauf eines Fahrzeugs berücksichtigt wären. Diese Kosten hätten die Städte dann vollständig allein zu tragen.
„Es drohen steigende Ticketpreise“
Trotz allem seien die Kommunen bereit, sich weiterhin für einen leistungsfähigen ÖPNV und dessen Ausbau einzusetzen, betonen Diener und Göbel. Ohne die überfällige Beteiligung des Landes und des Bundes drohten jedoch Angebotskürzungen und steigende Ticketpreise. Zur Begründung verwiesen die kommunalen Spitzen auch auf Angaben des Innenministeriums, nach denen das kommunale Defizit im ÖPNV für das Jahr 2024 auf knapp 450 Millionen Euro beziffert wurde. Die Prognosen für 2025 und 2026 sähen dabei eine ähnlich hohe Belastung vor.
Insgesamt schaffen es bereits 470 Pflichtaufgaben auf die Agenda. Zu den teuersten zählten dabei neben den ÖPNV-Kosten und der Schülerbeförderung die Ausgaben für die Sozial- und Jugendhilfe und die Aufnahme von Flüchtlingen. Als weitere „Großposten“ kämen außerdem Abfallentsorgung, Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung hinzu. Außerdem sorgen die Schulträgerschaft, der Bau und die Unterhaltung von Kreis- und Stadtstraßen, die Eingliederungshilfe und die Kindertagesstätten für finanziellen Aufwendungsbedarf. Nicht gespart werden dürfe außerdem beim Brand- und Katastrophenschutz, dem Gesundheitsamt und der Lebensmittelüberwachung.