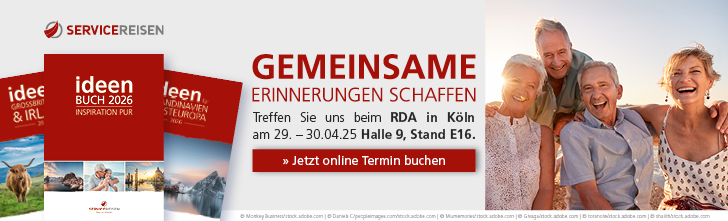„Wrightbus ist in Europa derzeit das am stärksten wachsende Unternehmen im Busbereich“, sagt Gales. „Zugleich sind wir das am stärksten wachsende Industrie-Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich.“ Eine halbe Milliarde Umsatz in Pfund – 600 Millionen Euro – erwirtschaftet Wrightbus mittlerweile pro Jahr, nachdem die Firma 2019 Insolvenz hatte anmelden müssen. „Ein Kunde war abgesprungen“, weiß Gales, „ein unternehmerisches Risiko, das uns zum jetzigen Zeitpunkt glücklicherweise nichts mehr anhaben könnte.“
Zur Schule ist der gebürtige Luxemburger mit dem Bus gefahren, mehr Verbindung hatte er nicht zu den Straßenkreuzern. Bis ihn im Februar 2023 Wrightbus-Eigentümer Jo Bamford anrief. Einen erfahreneren CEO hätte Bamford kaum finden können: Gales hat an Schlüsselstellen für das Who is Who der Autoindustrie gearbeitet, war unter anderem weltweiter Verkaufschef bei BMW und Mercedes, CEO bei Peugeot und Citroën in Paris, bei Lotus in Großbritannien, Chairman bei Williams. Jetzt könnte für ihn fast das Motto ‚Autos sind super, Busse sind superior‘ gelten. „Ich drehe mich nach jedem Bus um, den ich sehe und frage mich, was sich wie weiterentwickeln ließe.“ Gales verfolgt mit Wrightbus ambitionierte Ziele. 1947 von William Wright gegründet, begann das Unternehmen als Aufbauhersteller. Seit 2012 kommt aus dem Hause Wrightbus mit Body und Chassis fast das komplette Fahrzeug. Der Durchbruch gelang dem Unternehmen mit dem Routemaster Doppeldecker für London. In Deutschland könnte der Kite Hydroliner für den großen Wurf sorgen, ein ausschließlich mit Wasserstoff betriebener Bus mit elektrischer Brennstoffzelle. Nach Herstellerangaben schafft er eine Reichweite von bis zu 1.300 Kilometern, die Betankung dauert keine Viertelstunde. Über 1.000 Busse produziert Wrightbus heute jährlich, davon werden 2024 rund 100 Kite Hydroliner erstmals nach Deutschland geliefert. Weitere 55 folgen im kommenden Jahr. In den Rest Europas gehen heuer 200 Fahrzeuge. Neben dem Hauptwerk im nordirischen Ballymena gibt es ein weiteres in Malaysia, das den aufstrebenden asiatischen Markt abdecken soll und bis zu 800 Busse jährlich produzieren kann. Um im Wettbewerb bestehen zu können, hat Wrightbus in den vergangenen 15 Monaten seinen Entwicklungsschwerpunkt zunächst auf die Kostenoptimierung gelegt. „Man kann mit chinesischen Importen und auf dem asiatischen Markt nur punkten, wenn man in Bezug auf die Kosten einigermaßen wettbewerbsfähig ist – das sind wir jetzt“, so Gales. Wrightbus kauft deutlich günstiger ein als noch vor zwei Jahren, produziert selbst und profitiert vom Produktionsstandort in Nordirland, der zollfreie Exporte nach Europa erlaubt.
Die einzige Schwierigkeit momentan: Versierte Busbauer finden. „Wir mussten teilweise Leute aus unserem Werk in Malaysia nach Ballymena holen.“ Von 800 auf 2.000 ist die Anzahl der Wrightbus-Mitarbeiter am Hauptstandort angewachsen, innerhalb von anderthalb Jahren. In Großbritannien hat Wrightbus einen Marktanteil von 40 Prozent, lag in den ersten drei Monaten dieses Jahres im europäischen Vergleich auf Platz 1 bei der Produktion von Elektrobussen. Derzeit wird in den Ausbau des Service-Netzes investiert.
„Als ersten Service-Standort in Deutschland werden wir demnächst ein großes Service-Zentrum in Brühl bei Köln eröffnen“, verrät Gales. Mit der Regionalverkehr Köln GmbH ist dort auch der erste deutsche Großkunde von Wrightbus aktiv. „In Sachen Service fahren wir dennoch zweigleisig, denn unsere bisherige Strategie der mobilen Service-Teams hat sich sehr bewährt.“ Wrightbus-Busse seien gebaut, um 20 Jahre zu halten, eine effektive Nutzungszeit von 99 Prozent sei nachgewiesen. „Um das zu gewährleisten, beschäftigen wir in Großbritannien 68 Außendienstmitarbeiter, die mit voll ausgestatteten Lieferwagen zum Kunden fahren, wenn ein Problem auftaucht“, sagt Gales. „In Bicester haben wir unsere britische Serviceniederlassung, die nächstes Jahr von den derzeit 3.000 qm auf 6.000 erweitert wird. In Brühl steht unsere zweite in Europa in den Startlöchern, in Nord- und Süddeutschland sollen weitere folgen.“ Das Konzept der mobilen Teams soll auch in Deutschland umgesetzt werden. Die zweite Trumpfkarte, die Wrightbus im Ärmel hat, betrifft den Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen pflegt seit gut 30 Jahren eine Partnerschaft mit der Queens University in Belfast, einer der renommiertesten technischen Hochschulen in Großbritannien. Über ein Sponsoring-Programm fördert Wrightbus jedes Jahr zehn Doktoranden, einige der besten werden nach ihrer Dissertation eingestellt. Jeder Doktorand betreut zusätzlich zehn Diplomarbeiten. „Das macht 100 Diplomarbeiten pro Jahr, plus die Dissertationen – das bedeutet eine Menge hervorragenden Output bei vergleichsweise geringem Aufwand“, sagt Gales. „Eine wirklich exzellente Zusammenarbeit.“ In der näheren und ferneren Zukunft soll Wrightbus noch weiter wachsen. „Insgesamt peilen wir in Sachen Umsatz die volle Milliarde an. Außerdem wollen wir das Werk in Malaysia als Hub für den gesamten asiatischen Markt ausbauen und im Bereich Repower Dieselbusse zu Elektrobussen umbauen. Eine eigene Firma haben wir dafür bereits gegründet. Auf der Welle der Dekarbonisierung wollen wir führend werden.“ Die größte Herausforderung auf diesem Weg ist aus Jean-Marc Gales‘ Sicht die Politik. „Wir brauchen klare Vorgaben, auch und gerade, weil der Bus zusammen mit dem ÖPNV eben das Mittel ist, mit dem die Dekarbonisierung am elegantesten zu erreichen ist.“ Gales ist selbst gespannt, was die Zukunft bringt. „Letztlich ist es auch genau das, was mir am meisten Freude macht: Mit hervorragenden Leuten in einem hervorragenden Team ein Unternehmen weiter und weiter voranbringen, es verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen… .“ Irgendwann – vielleicht schon in vier bis fünf Jahren – will sich Wrightbus dann auch in Richtung USA orientieren.
Judith Böhnke